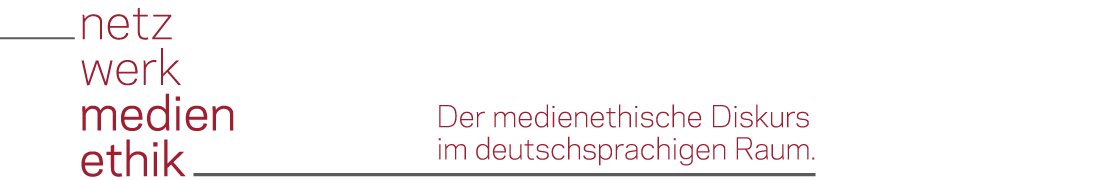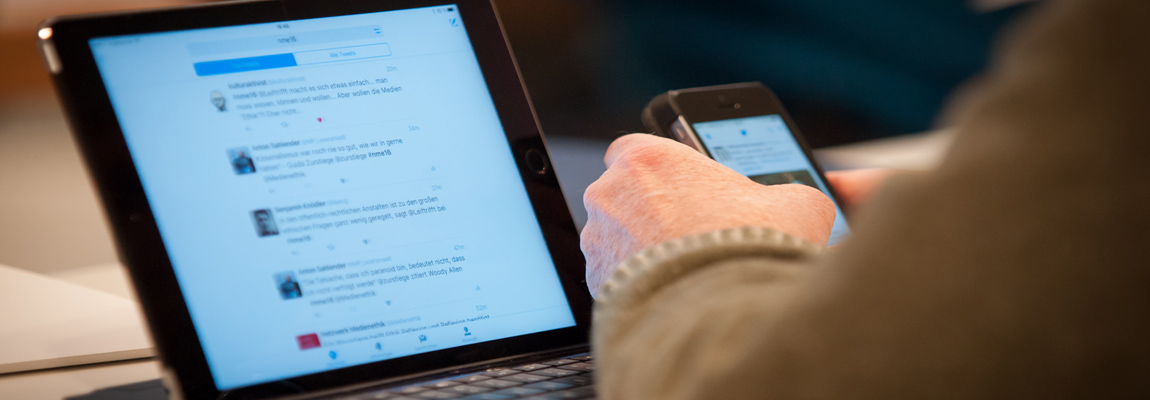Es wird immer deutlicher, dass die Präsidentschaft Trumps auch ein Feldzug gegen eine freie und plurale Medienlandschaft ist. Eine freie "Presse" mit einem der Demokratie und der Humanität verpflichteten Qualitätsjournalismus steht dem antidemokratischen Populismus seit jeher im Wege. Von dieser Warte aus sind die Angriffe Trumps auf die Medien verständlich. Trump und sein Berater Stephen Bannon haben jüngst eine neue Eskalationsstufe gezündet: die Medien werden als zu bekämpfende Oppositionspartei bezeichnet, unliebsame Medien werden von Pressekonferenze ausgeschlossen, der Präsident selbst sagt die Teilnahme am traditionellen Korrespondenten-Dinner ab.
Zu diesem Komplex hat jetzt der Medienforscher und Medienethiker Bernhard Debatin, von Anfang an aktiv im Netzwerk Medienethik, dem österreichischen Kurier ein Interview gegeben. Darin heißt es:
Die Medien sind für Trump „very fake“, „dishonest“ und „failing“; sie seien „ein Feind des amerikanischen Volkes“ – können Sie sich daran erinnern, wann sich zuletzt ein demokratisch gewähltes Staatsoberhaupt so abfällig gegenüber Medien geäußert hat?
Mir wäre niemand bekannt. Ich bin ziemlich erschüttert, dass ein Präsident eines Land, das sich als die Wiege der Demokratie versteht, derartige Kampagnen gegen die Medien fährt. Speziell unter dem Blickwinkel, dass Medien in der Demokratie eine wichtige Rolle haben – sie werden ja auch oft als vierte Säule der Macht neben Legislative, Judikative und Exekutive bezeichnet.
Lesen Sie das ganze Interview bei kurier.at.