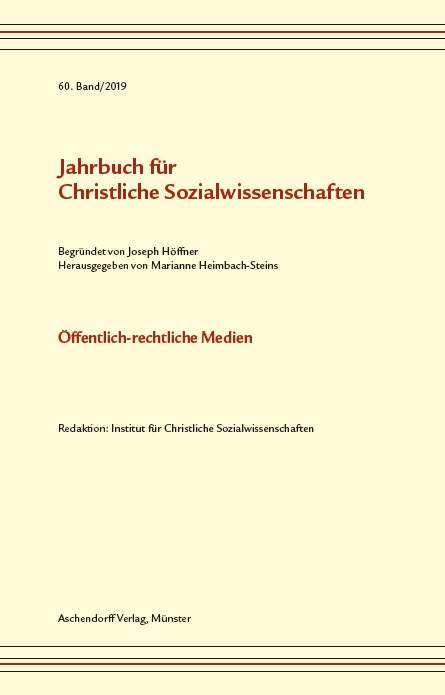 Der 60. Band des Jahrbuchs für Christliche Sozialwissenschaften greift die lebhaften und kontrovers geführten Auseinandersetzungen rund um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf und fragt nach einem Zusammenspiel von gelingender Demokratie und einem unabhängigen öffentlichen Rundfunk.
Der 60. Band des Jahrbuchs für Christliche Sozialwissenschaften greift die lebhaften und kontrovers geführten Auseinandersetzungen rund um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf und fragt nach einem Zusammenspiel von gelingender Demokratie und einem unabhängigen öffentlichen Rundfunk.
Durch populistische Diffamierungen, Framing-Debatten, politische Instrumentalisierungen und Zensierungen, bis hin zu Übernahmeversuchen öffentlich-rechtlicher Medienanstalten sind „die Öffentlich-Rechtlichen“ unter massiven Druck geraten. Dem gegenüber steht ein großes gesellschaftliches Bedürfnis nach „Unabhängigkeit“ und (weltanschaulicher) „Neutralität“ der medialen Vermittlung und Aufbereitung von Informationen.
Das erste Kapitel greift den vielschichtigen Bereich der öffentlich-rechtlichen Medien auf:
1. Ouvertüre
- Zur Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland – Klemens Kindermann
- Die Debatte um den öffentlichen Rundfunk in der Schweiz: Mit „NoBillag“ gegen das gesellschaftliche Solidaritätsprinzip – Vinzenz Wyss, Mirco Saner
- Public service broadcasting and media polarization in Poland – Michał Kuś
2. Forschungsbeiträge
- Öffentliche Medien als neue Intermediäre der Gesellschaft – Otfried Jarren
- Öffentlichkeitsbegriff und Gemeinwohlrelevanz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks – Alexander Filipović
- Antagonismus oder rationaler Diskurs? – Corinne Schweizer
- Öffentlich-rechtlicher Rundfunk in Europa: ein kennzahlenbasierter Vergleich zum Verhältnis von Finanzierung und Publikumsleistungen – Tobias Eberwein, Florian Saurwein, Matthias Karmasin
- Die Rolle der Kirchen in den Rundfunkräten – Siegfried Krückeberg
- Die Debatte um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist eine mediale Inszenierung – Beatrice Dernbach
3. Literaturüberblick
In diesem Kontext beleuchtet der aktuelle Band des JCSW unter rechtlichen/rechtsethischen, medien- und sozialethischen sowie politik- und kommunikationswissenschaftlichen Aspekten grundlegende Optionen einer politischen Ethik der Mediengesellschaft und der (Medien-)Demokratie.
Hier finden sie die vollständige Inhaltsangabe des Werkes.





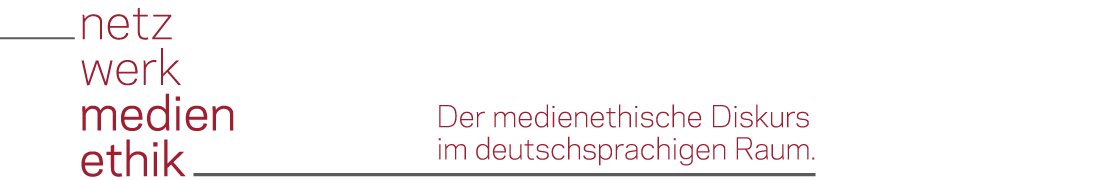


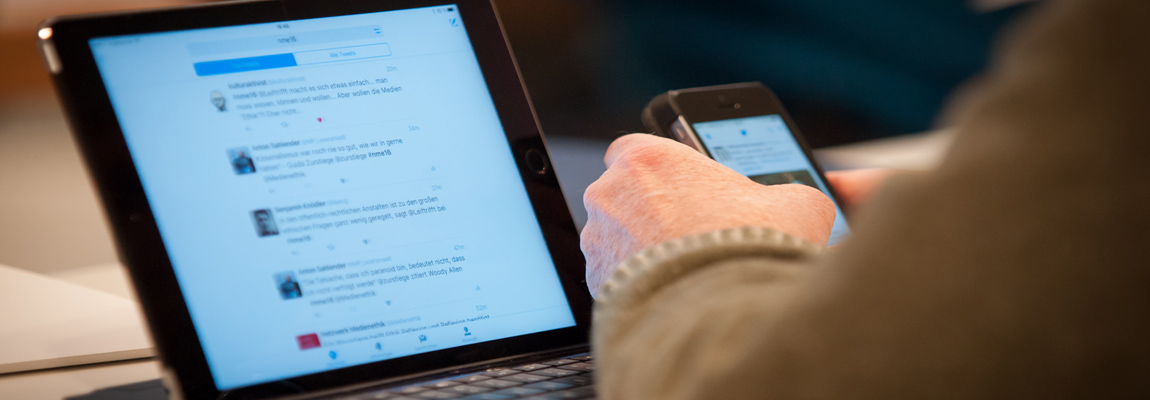


 Algorithmen fällen oder bereiten Entscheidungen vor, die Menschen in ihren Chancen und Möglichkeiten massiv nachteilig beeinflussen können. In Zukunft werden sie dies in immer mehr Fällen tun wie zum Beispiel in Bewerbungsverfahren, bei der Vergabe von Wohnraum, in der Kreditwirtschaft oder in der Medizin.
Algorithmen fällen oder bereiten Entscheidungen vor, die Menschen in ihren Chancen und Möglichkeiten massiv nachteilig beeinflussen können. In Zukunft werden sie dies in immer mehr Fällen tun wie zum Beispiel in Bewerbungsverfahren, bei der Vergabe von Wohnraum, in der Kreditwirtschaft oder in der Medizin.