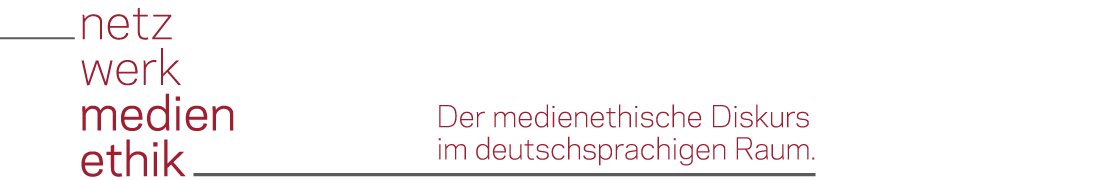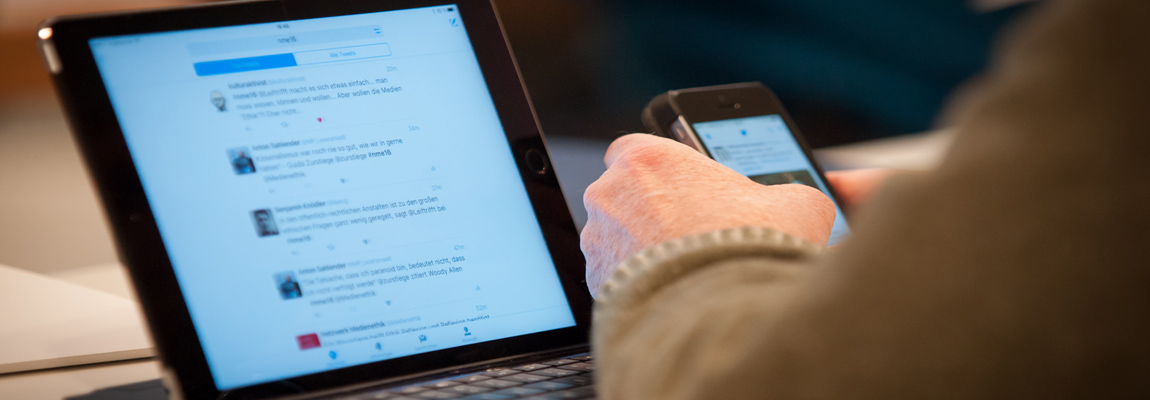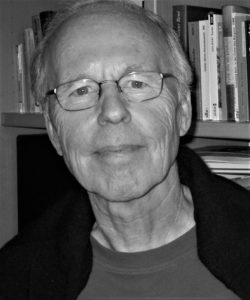
Foto: Horst Niesyto
Er gehörte zu den Gründern des „Netzwerks Medienethik“ (1997). Aber er hatte schon vorher angefangen, an die Produktion und Rezeption von Medien ethische Fragen zu stellen und Kommunikationswissenschaftler und Philosophen einzuladen, sie mit ihm zu beantworten. Herausgekommen sind seine vier Sammelbände zur Medienethik (1989; 1994; 1996; 1998). Aber voraus gingen Tagungen und Arbeitskreissitzungen an der Katholischen Akademie Stuttgart-Hohenheim, die er mit organsierte. So brachte er schon 1979 den theologischen Ethiker Alfons Auer dazu, Gedanken zur „Verantworteten Vermittlungsleistung“ der Medien zu entwickeln.
Stuttgart wurde zu seinem Lebensmittelpunkt, als er 30 Jahre wurde. 1942 in Krefeld geboren, studierte er in den 1960er Jahren – also während des II. Vatikanischen Konzils – in Rom Philosophie und Theologie. In seiner abschließenden Dissertation suchte er das Recht des Menschen auf Achtung und Schutz seiner Intimsphäre zu begründen. Diese anthropologische Perspektive scheint bei seinen eigenen Aufsätzen zur Medienethik auch immer wieder durch.