 Welche Bedeutung haben Medien für das Verhältnis von Jugend und Politik, welche politische Partiziaptionsmöglichkeiten ergeben sich für Jugendliche durch die Medien? Das Heft zum Thema "Jugend ohne Politik?" ist online erschienen; ein Text ist frei erreichbar. Eine Print-Ausgabe können Sie bestellen. Ein Highlight: Der Politikberater Erik Flügge spricht in einem Interview über politische Beteiligung junger Menschen. – Communicatio Socialis ist eine Zeitschrift für Medienethik und Kommunikation in Kirche und Gesellschaft.
Welche Bedeutung haben Medien für das Verhältnis von Jugend und Politik, welche politische Partiziaptionsmöglichkeiten ergeben sich für Jugendliche durch die Medien? Das Heft zum Thema "Jugend ohne Politik?" ist online erschienen; ein Text ist frei erreichbar. Eine Print-Ausgabe können Sie bestellen. Ein Highlight: Der Politikberater Erik Flügge spricht in einem Interview über politische Beteiligung junger Menschen. – Communicatio Socialis ist eine Zeitschrift für Medienethik und Kommunikation in Kirche und Gesellschaft.
Medienethischer Schwerpunkt: Jugend ohne Politik?
Seit 1953 ist die Wahlbeteiligung bei der älteren Bevölkerung wesentlich höher, als die der jüngeren. Die aktuelle Shell-Jugendstudie zeigt aber eine Trendwende. So bezeichneten sich 2015 immerhin 11 % mehr als politisch interessiert als noch 2002. Worin liegt dieser scheinbare Widerspruch begründet? Eine mögliche Antwort gibt die Jugendstudie der Friedrich-Ebert-Stiftung von 2015, die vor allem einen Vorbehalt der Jugendlichen gegenüber traditionellen Akteuren der Politik verzeichnet. Aber auch Brexit, Donald Trump und das Widererstarken des Rechtspopulismus als Herausforderungen der Demokratie könnten ein Weckruf für die junge Generation sein, sich auch in die institutionelle Politik einzubringen. Mit Blick auf die Bundestagswahl im Herbst 2017 hat die Zeitschrift Communicatio Socialis junge Menschen und politische Beteiligung zu ihrem Schwerpunkt gemacht.
Die Beiträge im Heft
Zum Auftakt lotet Thilo Hagendorff die medialen Potentiale von Partizipation aus. Im Fokus steht dabei, welche Rolle klassische und insbesondere neue Medien für die politische Sozialisation junger Menschen spielen. Katrin Geier und Klaus Meier untersuchen mit einer quantitativen Online-Befragung, wie junge Erwachsene politische Video-Nachrichtenformate wahrnehmen. Christa Gebel befasst sich mit der Nutzung von Online-Medien für politische Information und Beteiligung durch politisch interessierte Jugendliche. Wie digitale Jugendbeteiligung konkret funktionieren kann, zeigt Daniel Poli von der Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland (IJAB) an zwei E-Partizipationsprojekten auf.
Eine weitere Perspektive aus der Praxis liefert der Politikberater Erik Flügge im Interview. Er berät Städte und Gemeinden bei der Entwicklung und Umsetzung von Jugendpartizipationsprojekten. Zur Abrundung des Themenschwerpunktes kommen zwei junge Menschen zu Wort: Johanna Uekermann und Paul Ziemiak sind die Bundesvorsitzenden der Jugendorganisationen der SPD und der CDU/CSU. In ihren Beiträgen erzählen sie, warum sie tun, was sie tun und wie sie auch andere junge Menschen zur politischen Partizipation motivieren möchten.
Medienethischer Forschungsbeitrag: Film und Pokémon Go
Ralf Junkerjürgen schreibt über die ethische Herausforderung der filmischen Inszenierung von (School) Shootings. Denn die spielfilmische Darstellung derartiger Gewaltaktionen stellt eine ethisch besonders heikle Aufgabe dar, weil weder die Unterhaltungsfunktion des Films bedient, noch Gewalt verfremdet werden soll.
Maya Götz dokumentiert ihre Forschung zur Faszination der App Pokémon Go. Die Befragung von 1.661 Fans weltweit im Sommer 2016 gibt Einblick in die Hintergründe der Faszination und zeichnet nach, wie die App an die Erinnerung und Leidenschaft in Kindheit und Jugend anschließt und emotional involviert.
Kommunikation in Kirche und Gesellschaft
In der Rubrik Kommunikation in Kirche und Gesellschaft analysieren Tina Stanzel und Kristina Wied Kirchen-Akteure auf Facebook. Basis der Untersuchung ist eine Inhaltsanalyse von 159 Facebook-Postings zweier Akteure der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern zwischen Dezember 2015 und März 2016.
Serie „Grundbegriffe der Medienethik“ und "zuRechtgerückt"
In der Serie „Grundbegriffe der Medienethik“ behandelt der 8. Teil das Stichwort „Tranparenz" (Klaus Meier). Einen Überblick über die Serie finden Sie unter grundbegriffe.communicatio-socialis.de. In einer neuen Serie mit Namen "zuRechtgerückt" widmen sich Günter Bentele und Gabriele Faber-Wiener Fake-News über eine Pistenraupe von Seefeld.
Das neue Heft ist ab sofort online abrufbar. Wie gewohnt erscheint die neue Ausgabe auch in gedruckter Form. Die Zeitschrift Communicatio Socialis wird im verzögerten Open Access publiziert: 36 Monate nach Erscheinen eines Artikels ist er frei im Netz zugänglich. Eine Reihe von (Universitäts-) Bibliotheken haben Communication Socialis lizensiert und gewähren ihren Nutzer_innen Zugriff auf die aktuellen Inhalte (siehe diese Übersicht). Eine Reihe von Institutionen haben auch einen freien Zugriff auf die Inhalte durch größere Lizenzpakete.





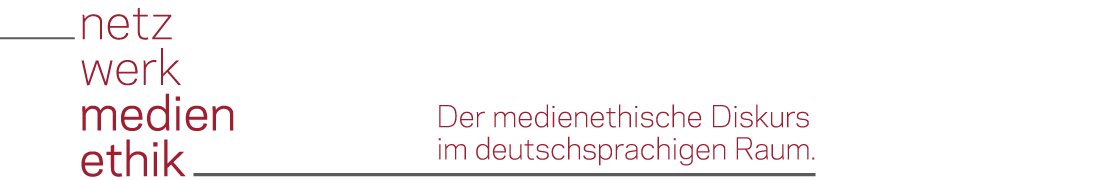


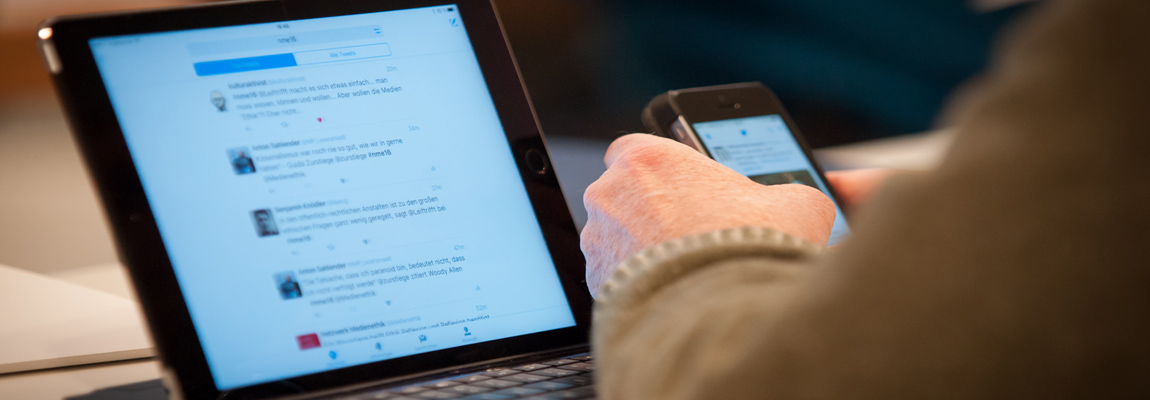


 Am vergangenen Mittwoch tagte der Deutsche Ethikrat in Berlin zum Thema „Autonome Systeme. Wie intelligente Maschinen uns verändern“. Über 500 Interessierte verfolgten die immer aktueller werdenden Diskussionen dazu, ob und in welcher Weise teilautonome und zunehmend auch hochautonome Systeme wie selbstfahrende Autos, Pflegeroboter, Smart Homes oder gar automatisierte Waffensysteme Autonomie und damit auch Verantwortung beanspruchen können oder sollten. Über gängige Dilemmata-Fragen hinaus wurden technische in Verbindung mit rechtlichen, sozialen und ethischen Fragen aufgegriffen und kritisch diskutiert.
Am vergangenen Mittwoch tagte der Deutsche Ethikrat in Berlin zum Thema „Autonome Systeme. Wie intelligente Maschinen uns verändern“. Über 500 Interessierte verfolgten die immer aktueller werdenden Diskussionen dazu, ob und in welcher Weise teilautonome und zunehmend auch hochautonome Systeme wie selbstfahrende Autos, Pflegeroboter, Smart Homes oder gar automatisierte Waffensysteme Autonomie und damit auch Verantwortung beanspruchen können oder sollten. Über gängige Dilemmata-Fragen hinaus wurden technische in Verbindung mit rechtlichen, sozialen und ethischen Fragen aufgegriffen und kritisch diskutiert.